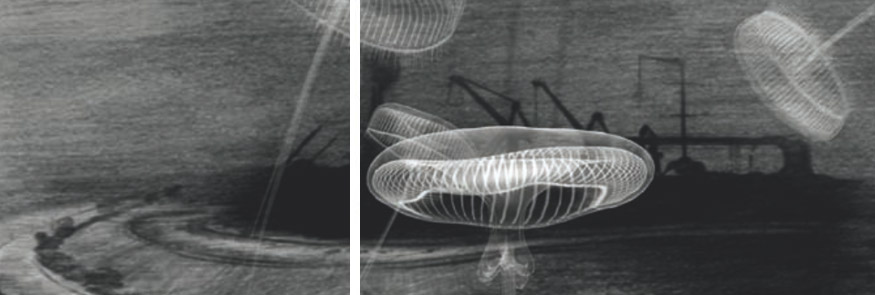
1
Der Umgang mit Niederlagen und Rückschlägen kennt viele Formen. Den Kopf einziehen, wenn es Schläge gibt, und unverdrossen auf bessere Zeiten hoffen ist nur eine davon. Der renommierte englische Essayist John Adams hat sich für Focus unter den Spielarten des Risikomanagements umgesehen und untersucht, wie man sich elastisch auf Krisen einstellt. Für die Ausbildung von Widerstandsfähigkeit scheint das Lernen aus Erfahrungen unerlässlich, und ein gesundes Urteilsvermögen spielt dabei für Adams eine große Rolle. Doch daraus ergibt sich ein Paradox: Die Mittel, erfolgreich mit Risiken umzugehen, sind selbst nicht ohne ein Risiko zu haben. Das Streben nach Resilienz wird so zu einem Balance-Akt, der immer mit der Gefahr des Absturzes verbunden ist.
Von John Adams
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT IST RELATIV. Es gibt keine Einheit, in der sie sich messen ließe, aber manche haben einfach mehr davon als andere. Die Fähigkeit, Niederlagen zu vermeiden und – falls sie dennoch eintreten – ihre Folgen abzumildern und sich von ihnen wieder zu erholen, ist nicht gleichmäßig verteilt.
Widerstandsfähigkeit hat auch Grenzen. Letzten Endes führt das Streben nach ihr ins Scheitern. Reiche zerfallen, Unternehmen gehen zugrunde, jedermann stirbt. Im geologischen Maßstab verschieben sich tektonische Platten, Eiszeiten kommen und gehen wieder, Meteoriten schlagen ein, die Sonne erkaltet. Im menschlichen Maßstab können Tsunamis, Erdbeben, Kreditkrisen, Krankheiten oder Verkehrsunfälle auch die Widerstandsfähigsten zugrunde richten. Dennoch versuchen wir, Niederlagen zu vermeiden, ihre Folgen abzumildern und uns von ihnen wieder zu erholen.
Eine flexible Antwort auf Krisen ist ohne den Umgang mit Risiken nicht zu haben. Als Risikomanager haben wir alle mit Risiken zu tun, die sich im Wesentlichen drei verschiedenen Typen zuordnen lassen.
Offenkundige Risiken sind mit bloßem Auge erkennbar. Mit ihnen kommen wir zurecht, indem wir unser Urteilsvermögen anwenden. So brauchen wir keine formale probabilistische Risikoeinschätzung, um über die Straße zu kommen. Eine Mischung aus Instinkt, Intuition und Erfahrung hilft uns für gewöhnlich unbeschadet auf die andere Seite.
Mittelbare Risiken sind nur mit Hilfe von Mikroskop, Fernrohr, Scanner und anderen Messgeräten, durch Untersuchungen und die aus ihnen gewonnenen Daten erkennbar. Das ist der Bereich des quantifizierten Risikomanagements. Hier wird das Maß der Unsicherheit durch die Wahrscheinlichkeit seines Eintretens bestimmt.
Virtuelle Risiken schließlich mögen existieren oder auch nicht – die Wissenschaftler sind sich uneins –, aber sie haben durchaus reale Auswirkungen. Diese Unsicherheit wirkt befreiend: Wo die Wissenschaft keine schlüssigen Antworten parat hat, fühlen sich Menschen berechtigt, aus ihren Annahmen, Überzeugungen, Vorurteilen oder aus Aberglauben heraus zu argumentieren. Hier müssen wir, wie im Fall der offenkundigen Risiken, anhand unseres Urteilsvermögens auf Einschätzungen zurückgreifen, die sich nicht objektiv bestätigen lassen. Der elastische Umgang mit Risiken lässt sich als ein Regelkreislauf denken. Unser Umgang mit Risiken wird zum einen bestimmt von unserer Bereitschaft, Risiken einzugehen, zum anderen von unserer Wahrnehmung dessen, was ein Risiko darstellt. Der Umgang mit Risiken führt entweder zu Erfolg und Belohnung oder zu Niederlage und Verlust. Der Regelungscharakter dieses Modells besteht nun darin, dass wir aus unseren Handlungen lernen: Die Erfahrung einer Belohnung wirkt in einer Schleife auf unsere
Risikobereitschaft zurück, das Erlebnis einer Niederlage auf unsere Risikowahrnehmung – und schafft so veränderte Voraussetzungen für das nächste Mal.
Bei manchen Menschen ist die Risikobereitschaft hoch, bei anderen ist sie niedrig, und bei niemandem gleich null – denn so ein Leben wäre unaussprechlich langweilig. Risikobereitschaft führt zu riskantem Verhalten, und das wiederum bringt ein Unfallrisiko mit sich. Ein Risiko eingehen heißt, etwas tun, das die Wahrscheinlichkeit eines negativen Ausgangs in sich trägt. Indem wir Unglücksfälle selbst durchleben und aus ihnen lernen, sie im Fernsehen sehen oder von unserer Mutter vor ihnen gewarnt werden, erwerben wir einen Sinn für Sicherheit und Gefahr. Wenn Risikobereitschaft und Risikowahrnehmung aus dem Gleichgewicht geraten, dann verhalten wir uns so, dass das Gleichgewicht möglichst wieder hergestellt wird: Widerstandsfähiges Verhalten ist im Kern ein Balanceakt.
Leiden an der Regulierung
Außerhalb der Finanzwelt mit ihren Wagniskapitalgebern, Hedgefonds-Managern und Subprime-Hypothekenmaklern ist der größte Teil des institutionellen Risikomanagements darauf ausgerichtet, negative Ereignisse zu vermeiden. Diese Form der Risikobewältigung konzentriert sich auf nur einen Teil des Regelkreislaufs, nämlich die Schleife aus Wahrnehmung – Verhalten – Niederlage und wiederum Wahrnehmung. Sie ist risikofeindlich. Doch wenn Menschen oder Gesellschaften Risiken vermeiden, bedeutet das nicht, dass sie dadurch auch automatisch widerstandsfähiger werden.
Die Vorbereitung auf Bedrohungen und der geschmeidige Umgang mit ihnen – mit einem Wort: Resilienz – verlangen die Verfügungsgewalt über Ressourcen. Der Bau von stabilen Dämmen und erdbebensicheren Gebäuden, die Einrichtung von Unfall- und Notfalleinsatzkommandos ebenso wie von Katastrophenhilfsdiensten stellen einen Luxus dar, den Arme sich nicht leisten können. Wer nur danach strebt, sich um jeden Preis gegen die Wechselfälle des Lebens zu schützen, verbaut sich den Weg zur Belohnung für Risiken – und damit zur Schaffung von Ressourcen, die Resilienz letztlich erschwinglich machen. Auch insofern bedeutet resilient zu werden, einen Balanceakt auszuführen. Zu wenig Vorsicht kann ins Verderben führen, zu viel davon die Initiative ersticken. Ich weiß von einem Unternehmen, in dem das (über-)eifrige Gesundheits- und Sicherheitsteam intern nur als „Verkaufsverhinderungsabteilung“ bekannt ist.
Die meisten reichen Länder werden immer weniger resilient. Sie leiden zugleich an Unter- und an Überregulierung. Die Deregulierung der Finanzmärkte hat einer relativ kleinen Gruppe von Financiers freie Hand gegeben, Anreizstrukturen zu schaffen, mit denen sie sich selbst fürstlich dafür entlohnen, ohne eigenes Risiko mit dem Geld anderer Leute zu spielen. Gleichzeitig werden andere Bereiche durch eine sinnlose Flut von Vorschriften und Reglementierungen erstickt. Das beste Beispiel in Großbritannien ist derzeit die neugegründete Independent Safeguarding Authority. Diese Behörde wurde kürzlich als Reaktion auf den Aufschrei der Boulevardpresse nach dem Mord an zwei jungen Mädchen ins Leben gerufen und hat die Aufgabe, circa neun Millionen Menschen, die in Großbritannien beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern arbeiten, auf Herz und Nieren zu prüfen. Teil der Untersuchung ist die Überprüfung des Strafregistereintrags jeder einzelnen dieser neun Millionen Personen. Erst nach dieser Überprüfung wird die Behörde, so ist auf ihrer Homepage nachzulesen, „bei jedem individuellen Fall entscheiden, ob die Person für diese Arbeit in Frage kommt“.
Der Wert eigener Erfahrung
Ganz abgesehen von den exorbitanten Kosten und dem administrativen Aufwand ist schon jetzt so gut wie sicher, dass die Aktion genau das Gegenteil von dem bewirken wird, was sie eigentlich erreichen soll. Indem man den Schutz der Kinder in die Hände der Bürokratie legt, verschiebt man nur die Verantwortung. Eine erfolgreiche behördliche Überprüfung durch das Criminal Records Bureau wird dann nämlich als Freibrief gelten. Auffälliges Verhalten und Verdachtsmomente, die früher Argwohn erweckt hätten, werden jetzt seltener hinterfragt oder verfolgt, denn schließlich hat die zuständige Behörde den Verdächtigen ja als „unbedenklich“ eingestuft. Aber der Schaden dieser großangelegten Aktion, die in keinem Verhältnis zu den Verbrechensfällen steht, wird noch viel größer. Schon jetzt erstickt sie die Bereitschaft zu Ehrenämtern in vielen Bereichen, die ohne die Teilnahme von Erwachsenen nicht auskommen. Von Musikorchestern und Laienschauspielgruppen bis hin zu Sport, Pfadfinderwesen, Sommercamps oder Schüleraustausch – überall ziehen sich bislang engagierte Menschen zurück, weil sie nicht bereit sind, die Kosten, Unannehmlichkeiten und Schikanen des Untersuchungsprozesses auf sich zu nehmen.
Aber es kommt noch schlimmer. Resilienz ist eine Fähigkeit, die nur durch Erfahrung erworben wird. In den USA, in Großbritannien und vielen anderen reichen Ländern ist in den letzten Jahrzehnten zu sehen, dass Eltern ihre Kinder nicht einmal mehr dem geringsten Risiko aussetzen wollen – eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass sich Kinder in diesen Ländern fast nur noch unter der Aufsicht von Erwachsenen bewegen dürfen. Der zusätzliche Rückgang der Zahl von erwachsenen Aufsichtspersonen führt nun dazu, dass der Bereich, in dem Kinder sich bewegen dürfen, noch weiter eingeschränkt wird – und sie vor ihren Fernsehschirmen und Spielekonsolen immer dicker werden. Zunehmend wird ihnen vorenthalten, eigene Erfahrungen zu machen und so den Balanceakt zu erlernen, der ihnen hilft, ihre Widerstandskräfte zu stärken.
Es ist Zeit, eine letzte Größe in unser Modell einzuführen: Die Art, wie Belohnungen auf die Risikobereitschaft und Niederlagen auf die Risikowahrnehmung einwirken, ist nicht bei jedem gleich, sondern wird bestimmt durch einen individuellen Wahrnehmungsfilter. Die Kulturtheorie, ein Zweig der Anthropologie, hat eine Typologie der häufigsten Reaktionen auf Risiken erstellt: Der Hierarchiker steht für den institutionellen Risikomanager, der die Regeln in unserer Gesellschaft festlegt und durchsetzt. Der übervorsichtige Egalitarier, den wir als Verteidiger der Umwelt oder ihrer gefährdeten Bewohner erleben, findet eher, dass die Obrigkeit nicht genug tut, um uns zu schützen. Der Individualist hingegen moniert, dass die Obrigkeit das Leben zu stark reglementiert und so unternehmerisches Handeln und persönliche Freiheit einschränkt. Die Risikomanagementstrategie des armen unbedarften Fatalisten hingegen – und das sind wohl die meisten von uns in der Mehrzahl der Fälle – besteht darin, den Kopf einzuziehen, wenn es gefährlich wird, und weiter Lottoscheine auszufüllen.
Ein schwieriger Balance-Akt
In großen Unternehmen kommt es immer mehr in Mode, einen Chief Risk Officer (CRO), einen Risikobeauftragten, zu bestellen. Diese neue Position scheint geschaffen worden zu sein, weil das Handeln der anderen Verantwortungsträger als Versagen erlebt wird – also das des Leiters der Finanzabteilung oder des Beauftragten für die Einhaltung von Regeln und Konzerngrundsätzen. In Finanzinstituten haben sie alle zusammen in spektakulärer Weise versagt, den jüngsten Subprime Crunch zu vermeiden – trotz allen Vorgaben und Ermahnungen von Turnbull, den Basler Abkommen, dem Sarbanes-Oxley Act und unzähligen Gesetzgebern. Die Frage ist jedoch: Werden die Chief Risk Officers tatsächlich einen besseren Job machen?
Die bisher Verantwortlichen hatten die Aufgabe, „Unfälle“ – meist in Form des Missachtens von Bestimmungen – zu vermeiden. Sie bewegten sich also innerhalb der Schleife Wahrnehmung – Verhalten – Niederlage und wieder Wahrnehmung. Wer aber ist die Instanz, in der alle Größen zusammenfließen und die letzten Endes den Balance-Akt ausführen muss, den wir als Streben nach Resilienz verstehen? Nach ihren Aussagen im Internet zu urteilen, sehen CROs ihre Aufgabe darin, „Risiken im Rahmen der Risikobereitschaft des Unternehmens zu managen“. Dieses Selbstverständnis aber deckt sich ziemlich genau mit der Aufgabenstellung des Vorstands und dessen Vorsitzendem, der sowohl für den Fortbestand des Unternehmens als auch für die Maximierung des Unternehmenswerts verantwortlich ist. Umgekehrt gilt daher auch: Der CEO wird zum CRO – zum Chief Resilience Officer.
Damit wird die Rolle von mathematischen Risikoexperten, die sich ausschließlich in der unteren Schleife des Modells bewegen und Risiko mit der Gleichung Risiko = Dimension der Konsequenz x Wahrscheinlichkeit adäquat abgebildet sehen, deutlich beschnitten.
Wir müssen vermeiden, uns wie der Betrunkene aus dem Witz zu verhalten, der seine Schlüssel verloren hat und sie unter der Straßenlaterne sucht – nicht weil er sie dort hätte fallen lassen, sondern weil er im Licht am besten sieht.
Was für Unternehmen gilt, das gilt für uns alle: Die Resilientesten sind die mit dem besten Sinn für das Gleichgewicht. Einige versuchen sich als Hochseilartisten, nehmen dafür ein großes Risiko in Kauf und finden ihren Erfolg großzügig belohnt. Andere bleiben lieber auf dem Boden und akzeptieren, dass die Belohnungen bescheidener ausfallen. Es gibt keine Zauberformel, die Erfolg garantiert. Wir, dieCEO/CROs und alle anderen, müssen vermeiden, uns wie der Betrunkene aus dem Witz zu verhalten, der seine Schlüssel verloren hat und sie unter der Straßenlaterne sucht – nicht weil er sie dort hätte fallen lassen, sondern weil er im Licht am besten sieht.
Machen wir uns nichts vor. Resilienz ist nicht kalkulierbar. Sie ist nicht quantifizierbar. Sie ist umstritten, und sie ist strittig. Wer resilient werden will, braucht vor allem eines: ein gutes Urteilsvermögen.

John Adams
John Adams ist emeritierter Professor für Geografie am University College London. Die Beschäftigung mit Verkehr und Transport führte ihn schon vor drei Jahrzehnten zur Auseinandersetzung mit dem Thema Risiko, das seitdem in seinen Arbeiten eine immer größere Rolle spielt. Adams ist unter anderem Ehrenmitglied des Institute of Risk Management und Träger des Essay-Preises von AIRMIC, der Association of Insurance and Risk Managers.
Illustration: Katja Davar, Shells on Mountain Tops (animation still), 2006, b/w, silent, 01:30 min





